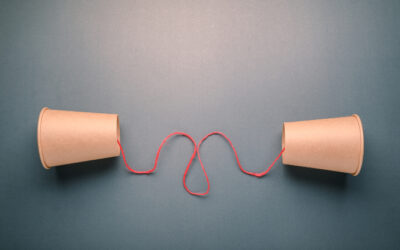Worum geht es in diesem Artikel
- Führungskräfte stehen zwischen Erwartungen „von oben“, den Bedürfnissen ihres Teams und eigenen Ansprüchen. Eine klare Abgrenzung ist deshalb unverzichtbar.
- Abgrenzung schützt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern stärkt auch Glaubwürdigkeit, Priorisierung und Führungsverantwortung.
- Abgrenzung erfordert Selbstklärung und eine klare Kommunikation.
- Methoden wie das „innere Team“ helfen, widersprüchliche innere Stimmen zu ordnen und zu einer klaren Haltung und Kommunikation zu kommen.
- Wer souverän Nein sagt, verbindet Empathie mit Klarheit und stärkt so sowohl die eigene Rolle als auch die Handlungsfähigkeit des Teams.
Abgrenzung ist mehr als Selbstschutz
Termin- und Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit: Das sind nur einige der Symptome unserer immer schnelleren, dynamischeren und komplexeren Arbeitswelt. Für Führungskräfte kommt dazu, dass die Erwartungen „von oben“, die Bedürfnisse des Teams und eigene Ansprüche aufeinandertreffen. Umso wichtiger ist es für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit, die eigenen Energien gezielt einzusetzen.
Dazu zählt die Fähigkeit sich abzugrenzen. Freundliche Führungskräfte, die nie Nein sagen und deren Tür immer offen ist, sind die reine Freude – vor allem für die anderen. Unabhängig von Berufserfahrung und Hierarchieebene begegnen mir in meiner Coachingpraxis regelmäßig Menschen, die sich ständig mehr aufladen als sie schaffen können.
Wer sich nicht abgrenzen kann, dauerhaft Ja sagt und eigentlich Nein meint, läuft Gefahr sich zu überlasten, Fehler zu machen und seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit auf das Spiel zu setzen. Hier gilt es, sich und seine Gesundheit selbst zu schützen.
Besonders wichtig für Führungskräfte: Mit jedem Ja verschieben sich auch Ihre Prioritäten. Das kann dazu führen, die eigenen Ziele bzw. die Abteilungsziele aus dem Blick zu verlieren. Aus unternehmerischer Sicht ist die Fähigkeit der Abgrenzung mehr als nur Selbstschutz. Sie sorgt dafür, dass Sie die Verantwortung für Ihre Aufgaben wahrnehmen und sich nicht von anderen fremd bestimmen lassen.
Fragen, die Sie sich stellen sollten
Fragen, die sich eine Führungskraft stellen sollte, bevor sie reagiert:
- Zahlt das Thema auf die strategischen Ziele des Unternehmens oder meines Bereichs ein?
- Was bedeutet ein Ja für meine Prioritäten bzw. die Prioritäten meines Teams?
- Welche Risiken entstehen, wenn ich Ja sage? Welche, wenn ich Nein sage?
- Wer sollte diese Aufgabe übernehmen? Bin ich die richtige Person oder gehört sie ins Team?
- Welche meiner aktuellen Projekte oder Verantwortlichkeiten bleiben liegen, wenn ich das übernehme?
- Welche Botschaft sende ich an mein Team, wenn ich diesen Auftrag annehme oder ablehne?
Wie lernt man Abgrenzung?
Das A & O der Abgrenzung ist eine klare Kommunikation. Aber: Wie geht das? Wir sind klar in unserer Kommunikation, wenn sie in Übereinstimmung mit uns selbst und unseren eigenen Bedürfnissen stattfindet. Wenn wir uns abgrenzen möchten, brauchen wir also erst einmal einen guten Zugang zu unseren eigenen Bedürfnissen und Anliegen, die uns unsere Grenzen bewusst machen.
Gleichzeitig hat Kommunikation auch eine zwischenmenschliche Dimension, denn die Kommunikation muss für die Situation mit unserem Gegenüber und für deren Kontext passend und angemessen sein.
Selbstklärung: der erste Schritt zu klarer Kommunikation
Stellen Sie sich vor, der Geschäftsführer kommt in Ihr Büro und sagt: „Ich habe da ein ganz wichtiges Projekt für Sie. Bitte übernehmen Sie das zusätzlich.“ Das Projekt klingt spannend und wichtig. Gleichzeitig wissen Sie, dass Ihre Kapazitäten und die Ihres Teams bereits voll ausgeschöpft sind. Und trotzdem sagen Sie ja.
Unsere Reaktion auf solche Ereignisse wird häufig von gemischten Gefühlen begleitet. Vielleicht haben Sie spontan „Ja, klar!“ geantwortet, und kurze Zeit später meldete sich Ihr Innenleben mit widersprüchlichen Wortmeldungen wie z.B.: „Wir sind schon am Limit. Wenn ich das zusätzlich übernehme, riskieren wir Qualität und Deadlines.“ oder „Ein wichtiges Projekt ist auch eine Chance, mich zu profilieren.“ oder auch „Das ist der Chef! Ich darf nicht Nein sagen, sonst wirke ich unkooperativ.“ In Gedanken kreisen Sie um die Situation mit Ihrem Chef und um Prioritäten, Machbarkeit und Führungsverantwortung, haben ein diffuses ungutes Gefühl, vielleicht begleitet von einem Druck im Bauch oder einem verspannten Nacken.
Vielleicht werden die beiden widersprüchlichen Seiten auch gleichzeitig in der Situation aktiv: Sie sagen z.B. „Ok, wenn es sein muss!“, während Ihr Tonfall resigniert klingt, Sie die Arme abwehrend verschränken und sich Ihre Stirn in Falten legt. Eine solche „inkongruente“ Äußerung führt zur Verwirrung beim Gegenüber. Welchem Teil der Botschaft soll er jetzt glauben: dem gesprochenen Wort oder der Körpersprache?
Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun hat deshalb auch das Credo ausgegeben: „Wer sich selbst versteht, kommuniziert besser.“ Es lohnt sich also, in sich selbst hineinzuhören. Sie werden überrascht sein, welches Stimmengewirr Sie in Ihrem Innersten vernehmen! In der Regel finden wir mehr als nur eine Stimme, die sich zu einem Thema oder einer Situation bemerkbar macht. Keine Sorge, ich möchte Ihnen keine gespaltene Persönlichkeit andichten. Diese innere Pluralität ist höchst menschlich und normal. Es sind innere Anteile, die unsere familiäre und kulturelle Erziehung, mit der wir groß geworden sind, sowie unsere persönlichen Lebenserfahrungen widerspiegeln. Diese Anteile vertreten demnach ganz unterschiedliche Positionen. Sie arbeiten miteinander, gegeneinander und vor allem durcheinander, und sie nehmen auf unsere Kommunikation und unser Verhalten Einfluss. Schulz von Thun hat für diese Pluralität von Anliegen die Metapher des „inneren Teams“ geprägt.
Das „innere Team“ als Instrument der Selbstklärung
Damit wir in der geschilderten Situation mit dem Chef künftig im Einklang mit unserem Innersten reagieren können, müssen wir erst einmal Kontakt zu dem wilden Haufen in uns aufnehmen. Die Selbstklärung ist eine wichtige Voraussetzung für klare Kommunikation. Das „innere Team“ von Friedemann Schulz von Thun ist dafür eine großartige Hilfestellung, gerade für Führungskräfte, die es sehr häufig mehreren Rollenanforderungen gleichzeitig zu tun haben.
So können Führungskräfte das „innere Team“ für die Selbstklärung nutzen:
- Am besten versetzen Sie sich in eine konkrete Situation, in der Sie widersprüchliche Gefühle hatten.
- Identifizieren Sie die „Stimmen“, die sich in dieser konkreten Situation gemeldet haben.
- Jedes dieser Teammitglied hat eine eigene Botschaft, die z.B. Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, Werthaltungen oder Befehle an uns selbst enthält. Notieren sie diese Botschaft.
- Sobald die Botschaft entschlüsselt ist, geben Sie der Stimme einen Namen.
- Machen Sie sich zudem bewusst, wie unterschiedlich die Stimmen sind und notieren Sie sich auch das. Welche Stimme ist eher laut? Welche leise? Welche meldet sich schnell und nimmt sofort Einfluss? Welche Stimme ist eher ein Spätzünder, meldet sich dafür aber umso heftiger? Welche Stimme ist dominant? Welche bleibt eher im Hintergrund?
Es kann sein, dass Sie innere Anteile entdecken, die Sie nicht mögen oder moralisch ablehnen. Hören Sie auch diesen Stimmen wertschätzend zu, denn irgendwann haben sie Ihnen gedient und wollen auch heute noch das Beste für Sie. Verdrängen Sie sie, melden sie sich oft über körperliche Symptome zurück.
Wählen Sie deshalb neutrale Namen wie „der, der alles zusammenhält“ statt abwertender Begriffe wie „Geizhals“. So entsteht ein wertschätzendes Arrangement Ihrer inneren Anteile. In der beschriebenen Situation hat möglicherweise ein impulsiver „Frühmelder“ dominiert, während die inneren „Profis“ zu spät kamen. Das ist ein typischer Grund für inneren Stress.
Welche „Teamaufstellung“ ist passend für Sie als Person?
Die gute Nachricht: Wir können unsere inneren Anteile gezielt ordnen und dadurch Klarheit gewinnen. Versetzen Sie sich dazu in eine Meta-Position als wertschätzender „Teamleiter“ Ihrer inneren Stimmen. Ziel ist, eine Vereinbarung zu treffen, die möglichst viele Anteile berücksichtigt und so zu einer authentischen Kommunikation führt.
Diese Fragen helfen bei der inneren Team-Aufstellung:
- Welche Stimme sollte zurücktreten, welche stärker hervortreten?
- Welche Vereinbarung ist nötig, damit widersprüchliche Anteile mitspielen?
- Welche Stimme fehlt und sollte ergänzt werden?
Unbewusst läuft eine solche innere Teamsitzung bei vielen Entscheidungen ohnehin ab. Bei schwierigen oder wiederkehrenden Situationen – etwa, wenn Sie nicht Nein sagen können – lohnt sich eine bewusste Selbstklärung. Unterstützung bietet dabei auch ein Coach, der mit der Arbeit an inneren Anteilen vertraut ist.
Welche „Teamaufstellung“ ist angemessen für die Situation?
Mit der Neuaufstellung Ihres inneren Teams haben Sie Klarheit über Ihre Haltung gewonnen. Nun stellt sich die Frage: Passt diese Haltung auch zur konkreten Situation? Ein Luther‘sches „Hier stehe ich und kann nicht anders“ kann je nach Kontext völlig in die Hose gehen. Als Führungskraft müssen Sie zudem nicht nur mit sich im Reinen sein, sondern auch die Rolle und den Kontext beachten.
Nehmen wir das Beispiel von oben: Die Geschäftsführung bittet Sie, ein „ganz wichtiges“ Projekt zusätzlich zu übernehmen. Hier lohnt es sich, kurz innezuhalten. Fragen Sie sich:
- Welche Aufgaben und Deadlines habe ich aktuell?
- Was bleibt liegen, wenn ich das neue Projekt übernehme?
- Welche Risiken entstehen für mein Team, wenn ich zusage?
- Welche Alternativen gibt es (später starten, Aufgaben umverteilen, Ressourcen einfordern)?
Eine klare Kommunikation bedeutet in diesem Fall nicht ein kategorisches Nein, sondern ein professionelles Gespräch über Prioritäten. Sie können z.B. auf der sachlichen Ebene aufzeigen, welche Folgen es hat, wenn Sie die neue Aufgabe übernehmen („Projekt XY bleibt liegen“). Bieten Sie Alternativen an („nicht jetzt, später“) und bitten Sie Ihren Chef um die Priorisierung der Aufgaben. „Damit ich die Qualität sicherstellen kann: Welche Priorität soll das neue Projekt im Vergleich zu den laufenden Aufgaben haben?“
So bleiben Sie loyal und lösungsorientiert, ohne sich oder Ihr Team zu überlasten. Ihre innere Klärung und die äußere Kommunikation greifen ineinander, Sie schützen Ihre Glaubwürdigkeit und stärken Ihre Führungsrolle.
Nein sagen zu Mitarbeitenden: Klarheit über Ihre Rollen
Möchten Sie als Führungskraft Nein zu Mitarbeitenden sagen, ist Rollenklarheit entscheidend. Sie sind nicht nur selbst betroffener Mensch, sondern tragen gleichzeitig mehrere „Hüte“:
- Der unternehmerische Hut: Ihre Entscheidung muss sicherstellen, dass das Team einen Beitrag zu den strategischen Zielen des Unternehmens leistet.
- Der Hut für Qualität und Effizienz: Sie gestalten Arbeitsabläufe so, dass sie realistisch und verlässlich bleiben.
- Der Hut als Teamcoach: Sie schaffen ein Umfeld, in dem Ihre Mitarbeitenden kooperieren und lernen können.
Nehmen wir folgendes Beispiel: Eine Mitarbeiterin bittet Sie mitten in einer wichtigen Projektphase um kurzfristigen Urlaub. Ihr erster Impuls ist vielleicht, Verständnis zu zeigen und flexibel zu reagieren. Gleichzeitig sehen Sie, dass eine Freigabe die Arbeitslast im Team verschärfen und wichtige Termine gefährden würde.
In Ihrer Selbstklärung meldet sich das innere Team: Der Helfer möchte Ja sagen, der Effizienzmanager warnt vor Überlastung, der Unternehmer denkt an die strategischen Ziele und der Coach an die Wirkung auf die übrigen Mitarbeitenden.
Die Kommunikation könnte dann so aussehen: „Ich verstehe, dass Sie sich eine Auszeit wünschen. Gleichzeitig stehen wir als Team kurz vor wichtigen Abgaben. In dieser Phase kann ich den Urlaub nicht freigeben. Lassen Sie uns nach den Deadlines sprechen und gemeinsam einen Termin finden, an dem es gut passt.“
So zeigen Sie Empathie und Wertschätzung, bleiben aber in Ihrer Führungsrolle klar: Sie setzen Grenzen im Sinne von Qualität, Strategie und Team und machen deutlich, dass Ihr Nein nicht gegen die Mitarbeiterin gerichtet ist, sondern für das gemeinsame Ziel.
Bereiten Sie typische Situationen vor
Nein sagen bedeutet für viele einen Bruch mit gewohnten Mustern. Auch wenn Sie Klarheit über Ihre Haltung gewonnen haben, ist es in der konkreten Situation oft schwer, spontan eine souveräne Absage zu formulieren.
Gerade für wiederkehrende Situationen lohnt es sich daher, die eigene Reaktion vorzubereiten. Orientieren Sie sich bei der Formulierung an Ihrer inneren Aufstellung.
Üben Sie Ihr Nein: vor dem Spiegel, mit einer Aufnahmefunktion oder mit einer Vertrauensperson. Achten Sie darauf, dass Stimme, Tonfall und Körpersprache Ihr Nein stützen und nicht abschwächen. Am Anfang wirkt das vielleicht ungewohnt, doch die Wirkung im Alltag zahlt sich schnell aus.
Überrumpelt? Verschaffen Sie sich Zeit
Trotz aller Vorbereitung kann es vorkommen, dass Sie von einer Situation überrascht werden – etwa, wenn eine Mitarbeiterin spontan Urlaub in einer heißen Projektphase beantragt. Spontan Ja oder Nein zu sagen, birgt hier Risiken: Sie laufen Gefahr, die falschen Prioritäten zu setzen oder das Team unnötig zu belasten.
In solchen Momenten ist es legitim, sich Bedenkzeit zu nehmen. Signalisieren Sie Verbindlichkeit und sagen Sie: „Ich möchte Ihre Anfrage ernsthaft prüfen. Lassen Sie uns morgen dazu sprechen.“
So gewinnen Sie Zeit für eine Selbstklärung mit Ihrem inneren Team und für eine nüchterne Analyse: Welche Prioritäten haben Vorrang, welche Alternativen gibt es, welche Folgen hätte ein Ja oder Nein? Mit dieser Klarheit können Sie anschließend eine Entscheidung treffen, die sowohl zu Ihrer Rolle als Führungskraft als auch zur Situation passt.
Ein paar Tipps für ein souveränes Nein
Es gibt ein paar Kniffe, die Ihre Abgrenzung für den anderen annehmbarer machen:
Nennen Sie einen Grund. Sie sind nicht verpflichtet, Ihr Nein zu begründen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass eine Begründung es Ihrem Gegenüber leichter macht, Ihre Entscheidung zu akzeptieren.
Vermeiden Sie Rechtfertigungen. Eine Begründung sollte kurz bleiben. Ausführliche Erklärungen klingen schnell nach Ausflüchten und schwächen Ihre Position.
Äußern Sie Verständnis, statt sich zu entschuldigen. Bei einem kurzfristigen Urlaubsantrag können Sie sagen: „Ich verstehe Ihren Wunsch nach einer Auszeit. Gleichzeitig müssen wir die Deadlines im Blick behalten – deshalb ist Urlaub in dieser Phase nicht möglich.“ So bleiben Sie empathisch, ohne die Verantwortung von sich wegzuschieben.
Verzichten Sie auf „Weichmacher“ wie möglicherweise, vielleicht, eigentlich, hätte, könnte. Relativierungen und Konjunktive sorgen dafür, dass bei Ihrem Kollegen kein klares Nein, sondern ein schwammiges Jein oder sogar ein Ja ankommt. Wer klar in seiner Kommunikation sein möchte, sollte diese Wörter weglassen.
Wechseln Sie auf die Metaebene, wenn nötig. Manche bleiben hartnäckig. Dann hilft eine klare Wiederholung auf Metaebene: „Ich sehe, dass Sie mein Nein nicht akzeptieren möchten. Ich muss es dennoch wiederholen: Unter den aktuellen Bedingungen kann ich dem nicht zustimmen.“ So zeigen Sie sowohl Klarheit als auch Respekt und stärken Ihre Position als Führungskraft.