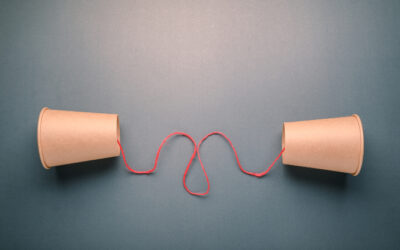Worum geht es in diesem Artikel
- Rund 70 % der Veränderungsprojekte scheitern, oft aus denselben Gründen.
- Häufige Ursachen: unklare Ziele, fehlende Einbindung, schlechte Kommunikation und das Ignorieren von Emotionen.
- „Klassische“ Top-Down-Reorganisationen greifen in komplexen Zeiten zu kurz. Das Verändern selbst muss sich verändern.
- Erfolgreich geschieht Veränderung unter Beteiligung der Führungskräfte und Mitarbeitenden, mit Kulturarbeit, einem Sinn für die Dynamik des Prozesses und der Bereitschaft, unterwegs anzupassen und zu lernen.
Warum scheitern so viele Transformationsprojekte?
Rund 70 Prozent aller Veränderungsprojekte gehen schief. Diese Zahl (manchmal liegt sie sogar noch höher) geistert zuverlässig seit Jahren durchs Netz. Sie basiert überwiegend auf Umfragen großer Beratungsunternehmen. Ich kann nicht sagen, wie valide sie ist.
Fakt ist: Die wirtschaftliche „Großwetterlage“ verlangt aktuell von den meisten Unternehmen, sich zu verändern. Seien es Digitalisierung und KI, der Zusammenbruch von Lieferketten, steigende Energiekosten, Kriege oder Krisen… Die meisten Unternehmen treibt derzeit die Frage um, wie in einem solchen komplexen Umfeld die eigenen Geschäftsmodelle gesichert oder verändert werden können, um zukunftsfähig zu sein.
Trotz der Dringlichkeit, die damit einhergeht, passieren immer wieder dieselben Fehler bei Transformationsprojekten. Unternehmen investieren viel Geld und Energie und vernachlässigen gleichzeitig die entscheidenden Faktoren, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. In diesem Artikel möchte ich den Fokus auf die Gründe legen, warum Veränderungsprojekte scheitern können. Und natürlich umgekehrt, welche Faktoren es gibt, um eine Transformation zum Erfolg zu bringen.
Wie Sie Ihre Transformation garantiert an die Wand fahren
1. Greifen Sie zu alten Konzepten
Um zukunftsfähig zu sein, ist für mich eine Frage zentral: Wie muss sich ein Unternehmen aufstellen, um für den Markt und die Kunden relevant zu bleiben? Ich denke dabei an ein Zukunftsbild einer resilienten und starken Organisation, die nicht nur ihre Probleme von heute löst, sondern sich schon für zukünftige Herausforderungen (die sicher kommen werden!) bereit macht.
Stattdessen sehe ich oft „klassische“ Reorganisationsprojekte, die in einem komplexen Umfeld einer linearen Top-Down-Logik folgen. Statt mit möglichst viel Expertise aus dem Unternehmen in Lösungsräumen zu denken, greifen Unternehmen auf ihre altbekannten Ansätze zurück, die sie per Durchgriff von oben als „Projekt“ durchplanen. Am Ende sorgen sie damit intern für Frust und sie verlieren Zeit und Marktanteile.
2. Kommunizieren Sie spät und unklar
Setzen Sie auf intransparente Kommunikation. Bleiben Sie unklar, was die Ziele und die Dringlichkeit angehen, so dass niemand versteht, warum der Wandel nötig ist. Geben Sie Informationen scheibchenweise heraus, nutzen Sie unverständlichen Fachjargon und sorgen Sie dafür, dass Führungskräfte unterschiedliche Botschaften senden. Am besten halten Sie Monologe und senden lange Emails statt Dialogformate anzubieten. So entsteht garantiert Misstrauen und der Flurfunk hat Hochkonjunktur.
Wirksame Kommunikation hingegen beginnt so früh wie möglich. Sie ist klar, verständlich und ehrlich. Veränderung braucht ein „Warum“, das verständlich ist und ein möglichst attraktives Zukunftsbild zeichnet, damit sich der Einsatz lohnt. Führungskräfte treten mit einer gemeinsamen Botschaft auf, erläutern den Sinn der Veränderung und schaffen Räume für Dialog. Mitarbeitende können Fragen stellen, Sorgen äußern und ihre Perspektiven einbringen. So entsteht im besten Fall Transparenz und Vertrauen. Das ist die Basis dafür, dass Menschen Veränderung mittragen.
3. Lassen Sie die Führungskräfte außen vor
In vielen Transformationsprojekten wird die mittlere Führungsebene genauso von der Veränderung überrascht wie die übrigen Mitarbeitenden. Das sorgt zuverlässig dafür, dass Führungskräfte nicht mitziehen und sich selbst als ohnmächtig erleben. Führungskräfte sind die zentralen Übersetzer von Strategie in Alltag. Sie müssen Orientierung geben und Sinn vermitteln. Wenn Führungskräfte nicht als Vorbilder auftreten und selbst unsicher wirken, können Sie sicher sein: Auch die Mitarbeitenden werden skeptisch bleiben. Meine Empfehlung lautet deshalb: Binden Sie die Führungsmannschaft ein. Nicht nur, um den Prozess mitzugestalten, damit sie u.a. ihren Teams Orientierung geben können. Es geht auch darum, die (Verlust-)Ängste der Führungskräfte mitzudenken und Raum für deren Unsicherheiten zu schaffen.
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund, Führungskräfte in Veränderungsprozesse einzubinden. In komplexen, sich schnell ändernden Umfeldern muss sich Führung grundsätzlich ändern. Führungskräfte sind die ersten, die den Umgang mit Komplexität, Widersprüchen und Ungewissheit lernen sollten. Für mehr Agilität braucht es eine coachende, entwickelnde, moderierende Führung. Führungskräfte, die sich als Unterstützer und Befähiger ihrer Teams verstehen, Orientierung geben und Kooperation fördern.
4. Halten Sie Mitarbeitende aus dem Prozess heraus
Um eine Veränderung scheitern zu lassen, treffen Sie Entscheidungen am besten im kleinen Kreis. Geben Sie den Mitarbeitenden keine Verantwortung und keine Gestaltungsmöglichkeiten. So fühlen sich Mitarbeitende übergangen und ohnmächtig und entwickeln zuverlässig Widerstand. Die Konsequenzen sind vermindertes Engagement und innere Kündigung. Mal ehrlich: Das braucht niemand für die Zukunft seines Unternehmens.
Meine Empfehlung ist: Binden Sie Ihre Mitarbeitenden in die Gestaltung des Veränderungsprozesses ein. Sie sind nah am Markt und an den Kunden. Sie können Herausforderungen und Entwicklungsbedarf benennen, die Sie nicht auf dem Schirm haben, und dafür Lösungsstrategien erarbeiten. Die Teilhabe ist zudem ein gutes Mittel gegen das Gefühl von Kontrollverlust („Ich kann mitgestalten“). Wenn Mitarbeitende spüren, dass ihr Beitrag zählt, tragen sie den Wandel aktiv mit.
5. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf das Organigramm
Zeichnen Sie ein neues Organigramm und denken Sie in Hierarchien und Berichtslinien. Lassen Sie kulturelle Einflüsse und Prozesse beiseite. So stellen Sie sicher, dass alte Verhaltensmuster die schöne neue Struktur sofort wieder einholen.
Zugegeben: Man kann nicht direkt an der Kultur arbeiten (auch wenn davon viel die Rede ist). Kultur ist immer ein Ergebnis: Sie entsteht durch die Regeln, Muster und Strukturen im Unternehmen, die das Verhalten der Menschen prägen. Aber man kann die Kultur beeinflussen, indem man formelle und informelle Strukturen in einem Unternehmen beleuchtet, die das tatsächliche Verhalten der Mitarbeitenden prägen. Und indem man Rahmenbedingungen und Strukturen schafft, die ein erwünschtes Verhalten möglich machen.
6. Ignorieren Sie Emotionen
Tun Sie so, als sei Veränderung ein rein rationaler Vorgang. Angst vor Statusverlust? Sorge um den Arbeitsplatz? Unsicherheit über die eigene Rolle? Am besten gar nicht erst thematisieren. Damit sorgen Sie sicher dafür, dass das Schreckgespenst Widerstand mit am Tisch sitzt.
Sie könnten es aber auch anders angehen. Wir Menschen sind alle keine Fans von Veränderungen. Emotionale Reaktionen wie Unsicherheit, Angst oder Überforderung sind normale Begleiter von Veränderung, und Widerstand ist oft ein Signal für Ungeklärtes und Unausgesprochenes. Werden diese Emotionen benannt und bearbeitet, kann Vertrauen und Energie für Neues entstehen. Meines Erachtens ist das eine der wichtigsten Aufgaben in Veränderungsprozessen: einen guten Raum für Veränderung schaffen, damit Menschen sich einlassen können.
7. Ignorieren Sie die Dynamik des Prozesses
Planen Sie Ihr Veränderungsprojekt von Anfang bis Ende durch und halten Sie um jeden Preis am ursprünglichen Plan fest. So verpassen Sie die Chance, aus Erfahrungen zu lernen und Kurskorrekturen vorzunehmen.
Veränderung ist ein iterativer Weg. Die Frage, die ich mir als Organisationsentwicklerin regelmäßig stelle, ist: Was braucht das Unternehmen jetzt als nächstes? Reflexions- und Lernschleifen sowie Feedbackrunden helfen, die Dynamik des Prozesses aufzugreifen, damit umzugehen und handlungsfähig zu bleiben.
Fazit
Viele Veränderungsprojekte scheitern leider an der Art und Weise, wie sie umgesetzt werden: unklare Ziele, fehlende Beteiligung, schlechte Kommunikation, übersehene Emotionen. Dazu kommt: Die herkömmlichen Change-Methoden helfen nicht, um die komplexen Probleme von heute anzugehen. Das Verändern selbst muss sich verändern.
Gestalten Sie Ihr Zukunftsbild gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden. Menschen sind in der Lage, ihre Organisation selbst zielgerichtet weiterzuentwickeln. Denn Veränderung gelingt nicht mit Ansage von oben oder fertigen Konzepten, sondern nur mit echter Beteiligung. Das ist kein Selbstzweck: Wenn Menschen sich selbstwirksam und kompetent erleben, ist das die Basis für die Wertschöpfung eines Unternehmens. Und nehmen Sie sich im Zweifel eine erfahrene Organisationsberatung an Bord. Während Sie die nötige Branchenerfahrung haben, hat die Beraterin oder der Berater das Transformations-Knowhow und weiß, worauf es im Veränderungsprozess ankommt, damit er erfolgreich sein kann.